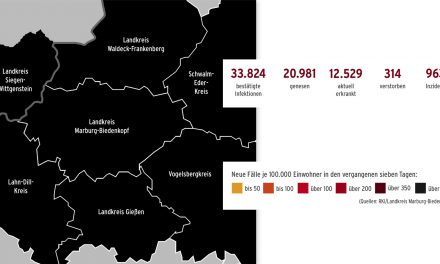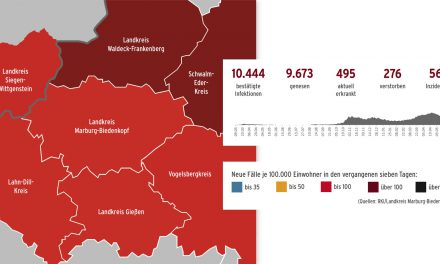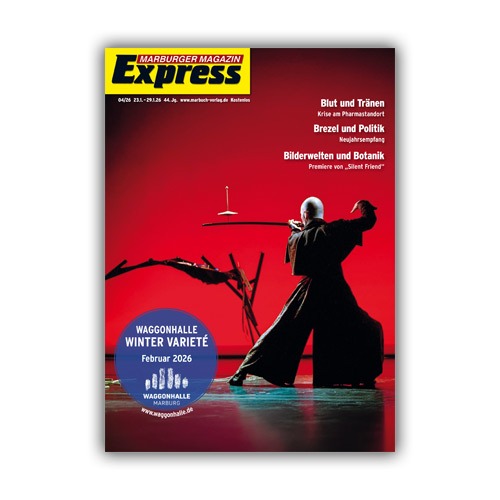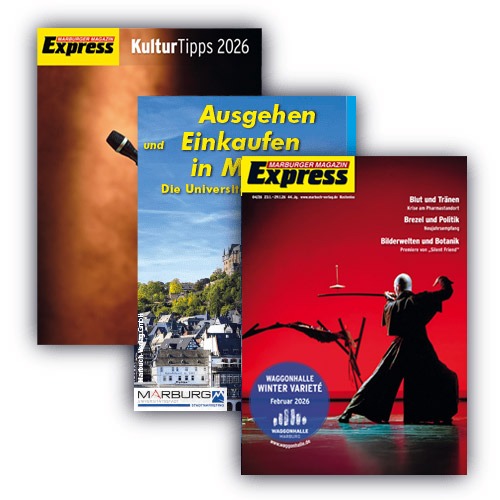Briefe aus dem Holocaust, der Jazz-Pianist Ted Rosenthal und die Uni Gießen.
Die Szene aus der Jazz-Oper von Ted Rosenthal kommt ganz alltäglich daher: Studierende und Professoren klagen über zu viel Arbeit, zu viel Lernstoff und überlaufene Veranstaltungen – so, wie es auch heute noch an fast jeder Hochschule zu erleben ist. Doch der Song „Too Many Jews“ beschreibt die Stimmung der Universität Gießen im Jahr 1933. Aus zu viel Arbeit wird „zu viele Juden“. Die Stimmung kippt. Aus Freunden und Kommilitonen werden Feinde, die den Juden im Hörsaal zum Sündenbock machen. Er muss gehen. „Germany first“ heißt es im Stück.
Der Jude im Raum, das ist Erich Rosenthal, der Vater des amerikanischen Jazz-Pianisten und Komponisten Ted Rosenthal. Und Erich Rosenthal musste sein Studium der Neueren Philologie in Gießen jäh unterbrechen. Weil er „nicht-arisch“ war, warf ihn die Hochschule am 5. Juli 1933 raus.
Aus der Lebensgeschichte seines Vaters, dem Verlust seiner Familie, der Ankunft in der neuen Welt und den Schuldgefühlen des Holocaust-Überlebenden hat sein Sohn Ted Rosenthal eine Jazz-Oper gemacht. Auszüge daraus werden am 28. Mai ab 20 Uhr im Hermann-Levi-Saal im Rathaus von Gießen zu hören sein. Der mehrfach preisgekrönte Komponist aus New York kommt auf Einladung des Instituts für Musikwissenschaft und Musikpädagogik der Universität Gießen. Er gilt als einer der wichtigsten Jazz-Pianisten seiner Generation und arbeitete mit Musikern wie Gerry Mulligan und Art Farmer zusammen. Glücklicherweise lässt sich die eigentlich für elf Musizierende und 15 Sängerinnen und Sänger ausgelegte Oper auch im Trio spielen. In Gießen spielt er zusammen mit Martin Gjakonovski am Bass und Berthold Möller am Schlagzeug. Vor dem Konzert wird um 19 Uhr der Sammelband „Erinnerungskulturen und Demokratiebildung“ vorgestellt, der aus der bisherigen Zusammenarbeit des Instituts und Ted Rosenthal hervorgegangen ist. Der Eintritt ist frei.
2016 hat Ted Rosenthal die Jazz-Oper mit dem Titel „Dear Erich“ geschrieben, die bis weit nach Mittelhessen reicht. Der in Wetzlar aufgewachsene Vater des Komponisten – Erich Rosenthal – war im Frühjahr 1938 vor den Nazis geflohen, um an der Universität Chicago zu studieren. Zurück blieben seine Eltern und viele Familienmitglieder, die den braunen Terror nicht überlebten. Erich Rosenthal heiratete, bekam zwei Kinder und wurde Soziologieprofessor an der City University of New York. Über die tragische Vergangenheit seiner Familie sprach er nie.
Doch nach dem Tod seines Vaters entdeckte Ted Rosenthal eine Kiste mit Briefen auf dem Dachboden seines Elternhauses auf Long Island – mehr als 200 Briefe, die seine Großmutter Herta an ihren Sohn geschrieben hatte. Die Briefe waren auf Deutsch und in Sütterlin geschrieben. Ted Rosenthal beherrscht weder das eine noch das andere. Doch den Gedanken an die Briefe nahm er mit nach Bad Camberg, der kleinen Stadt im Hintertaunus, aus der die Familie seiner Großmutter stammt. Dort war er gemeinsam mit weiteren Nachkommen der jüdischen Gemeinde zur Eröffnung der renovierten Alten Jüdischen Schule eingeladen worden, einem Fachwerkgebäude, das bis 1838 als Synagoge der Stadt diente.
Vor Ort kam er ins Gespräch mit Peter Schmidt, dem Direktor des örtlichen Geschichtsvereins. Und dieser übersetzte die Briefe. Erst dadurch erfuhr Ted Rosenthal vom Schicksal seiner Familie: „Eine ganze Welt begann sich zu öffnen, eine Welt voller Familie, Familienfreunden, Menschen und Orten, die ein wesentlicher Bestandteil der Kindheit meines Vaters waren“, erzählt er. Über die Briefe lernte er Großeltern, Tanten, Onkel und Cousins kennen. Er erfuhr von Hertas „ironischem Sinn für Humor“ und der Mühe, die sie sich gab, um ihren Sohn nicht zu beunruhigen.
Sein Vater hatte nie über die Familie gesprochen. „Everything, My Father Never Told Me“, heißt der Opern-Song, der dieser Frage nachspürt. Seine Großmutter Herta schrieb die Briefe von ihrem Wohnort in Wetzlar aus in der Zeit von 1938 bis zu ihrer Deportation im November 1941. Sie wurde im polnischen Konzentrationslager Sobibor ermordet. Erich Rosenthal hatte verzweifelt versucht, seine Eltern nachzuholen, scheiterte jedoch. Er selbst hatte rechtzeitig emigrieren können, weil er von Louis Wirth unterstützt wurde, einem deutsch-jüdischen Soziologen der Chicagoer Schule. Die Schuldgefühle, die Erich Rosenthal sein Leben lang verfolgt haben, sind ein zentrales Thema der Oper.
Als der Jazz-Pianist um Kontakt mit der Uni Gießen bat, wurde dies auch zu einem „elementaren Wunsch von uns allen“, formuliert Schlagzeugdozent Berthold Möller. Was der heute 65-Jährige zu erzählen hatte, habe das ganze Team „emotional tief gepackt“. Das Institut, das traditionell einen Schwerpunkt bei Jazz hat, organisierte 2023 eine interdisziplinäre Veranstaltungsreihe zu Demokratiebildung und Erinnerungskulturen, zur Geschichte der Uni Gießen während der NS-Zeit und den Chancen der Pädagogik. Neben einem Seminar für die Studierenden referierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über Themen wie Musik der rechten Szene, Holocaustliteratur, Konfrontation mit der NS-Geschichte sowie Musik und Trauma. Mit der Reihe wollten die Beteiligten auch ein Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung in der Gegenwart setzen.


Für die Gießener Musikpädagogik ist die Auseinandersetzung mit politischen Themen eine Selbstverständlichkeit. So erfahren die Studierenden, wie Musik in der rechten Szene funktioniert und wie sie während der NS-Zeit instrumentalisiert wurde, um ein ideologisch aufgeladenes Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen: „Es ist wichtig, die Formen der Hetze zu erkennen“, sagt Berthold Möller.
Die von der „New York City Opera“ in Auftrag gegebene Oper von Ted Rosenthal wurde im Januar 2019 in New York uraufgeführt. Bei den Texten handelt es sich zum großen Teil um vertonte Briefe, es kommen aber auch fiktive Elemente vor. Ungewöhnlich sei die Kombination aus Jazz-Harmonik und Operngesang, sagt Berthold Möller. Der Schlagzeug-Dozent erzählt vom großen musikalischen Reichtum der Oper, die „sehr moderne Harmonien“ und viele „unterschiedliche Jazz-Stilistiken“ beinhalte. Künstlerisch sei die Oper „wie ein Brennglas“. Sie verdichte das Lebensschicksal und die Geschichte so, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ein unmittelbares Gefühl für die Wirklichkeit dieser Zeit bekommen.
Gesa Coordes