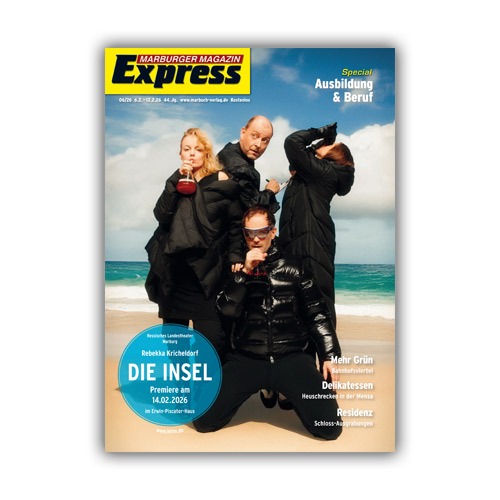Uni Gießen erwartet 400 Engagierte für Agroforst
Die Bilder sahen aus wie in den Überschwemmungsgebieten der Eifel: Überflutete Straßen, Geröllberge, Schlammmassen und Autofahrer, die mit Schlauchbooten befreit werden mussten. Der Bahnhof und das Gleisbett von Aumenau (Kreis Limburg-Weilburg) waren überschwemmt. Und auch der deutlich höher gelegene Gladbacherhof, der Lehr- und Versuchsbetrieb für Ökologischen Landbau der Universität Gießen, wurde getroffen. Am 5. Juli 2018 wurden mehrere hundert Tonnen des nährstoffreichen, fruchtbaren Bio-Oberbodens auf den Feldern in der Hanglage weggespült. An diesem Tag fiel innerhalb von einer Stunde ein Sechstel des üblichen Jahresniederschlags. „Es sah verheerend aus“, erinnert sich Andreas Gattinger, Professor für Ökologischen Landbau. Dabei hatten die Forschenden auf dem Vorzeigebetrieb noch Glück, weil der Mais schon zwei Meter hoch stand. Gattinger: „Es war nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir in Nordrhein-Westfalen und Rheinlandpfalz gesehen haben.“
Für das Team um den Professor für Ökologischen Landbau waren die Sturzbäche der Anlass, um ihre Agroforst-Forschungen weiter voranzutreiben. Ihre Vorhersage: Extremwetter wie diese werden sich im Zuge des Klimawandels häufen. Und mithilfe von Agroforst sind die Folgeschäden geringer. Zu diesem Thema veranstaltet die Justus-Liebig-Universität nun gemeinsam mit dem Fachverband für Agroforstwirtschaft in dieser Woche das zehnte Forum Agroforst mit zahlreichen Vorträgen, Workshops und Exkursionen. Rund 400 Engagierte werden erwartet. Gattinger ist einer der Hauptredner.
Agroforst steht für eine Landwirtschaft mit Bäumen. Eigentlich handelt es sich dabei um ein altes System, erklärt Dr. Philipp Weckenbrock, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Gießener Uni-Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung. Typisch seien die Streuobstwiesen, auf denen Kühe weideten. Aber auch auf den Feldern waren Bäume bis in die 50er Jahre hinein häufig. Dies änderte sich durch die großen Landmaschinen, denen die Bäume im Weg standen. „Bis in die 70er Jahre gab es Prämien, um diese Bäume zu fällen“, sagt Weckenbrock.

Der Geograf, der mehrere Jahre auf Biobauernhöfen in verschiedenen Ländern gearbeitet hat, lernte das Agroforstsystem in Bolivien und Brasilien kennen. Dort gibt es sehr ertragreiche Kakaoplantagen, die auf das Wissen indigener Völker zurückgehen. Kombiniert mit einheimischen Büschen und Bäumen entsteht dabei ein „Nutz-Dschungel“ mit hohen Erträgen, der zugleich ein „grandioses Ökosystem“ bildet, so Weckenbrock. Er ist sich sicher: „Man kann viel produzieren und zugleich eine artenreiche Natur haben.“
Agroforst soll nämlich nicht nur die Erosion verhindern, sondern auch die Artenvielfalt erhöhen, Kohlenstoff speichern, die Produktivität stabilisieren und die Bodenqualität verbessern. Gattinger, der den Agroforst während seines Studiums im schottischen Aberdeen kennenlernte, holte den Experten nach Gießen. Schon bei dem Hochwasser 2018 hatte sich gezeigt, dass einzelne Haselnusssträucher wie ein Bollwerk gegen die Fluten gewirkt hatten.
2020 begann das Projekt auf dem Gladbacherhof, der seit 40 Jahren ökologisch bewirtschaftet wird. Auf dem Lehr- und Versuchsbetrieb haben die Gießener Forscherinnen und Forscher drei einfachere und ein komplexeres Agroforst-System angelegt, das sich an der natürlichen Artenfolge orientiert. 18 Meter breit sind die Ackerstreifen, die sich an der Breite von Pflügen und Erntemaschinen orientieren. Alle zehn Meter lockt eine Sitzstange für Greifvögel, die zugleich Mäuse in Schach halten. Die Felder werden im achtjährigen Fruchtfolgewechsel des Gladbacherhofs bewirtschaftet. Drei Meter breit sind die Baumstreifen, die insgesamt einen Kilometer lang sind.
Die Forschenden sind davon überzeugt, dass sich unterschiedliche Baumarten gegenseitig fördern. Zudem gehen sie davon aus, dass die Grünstreifen auch bei Trockenperioden helfen. Weil der Wind gebremst wird, verdunste weniger Feuchtigkeit. Dicke Mulchschichten halten die Bodenfeuchtigkeit auf den Baumstreifen. „Wir versuchen, die Felder wie Schwämme zu gestalten“, sagt Weckenbrock.
Mit dem ausgeklügelten Agroforst-System betritt der Gladbacherhof Neuland: „So etwas gibt es in Deutschland noch kaum“, so Weckenbrock. Freilich geht der Forscher davon aus, dass sich die Vorteile des Systems erst auf Dauer zeigen. Davon würden allerdings auch konventionell arbeitende Landwirtinnen und Landwirte mit erosionsgefährdeten Feldern profitieren. Weckenbrock: „Agroforst ist ein Hoffnungsträger.“
Gesa Coordes
Weitere Informationen: agroforst-info.de/forum-agroforstsysteme