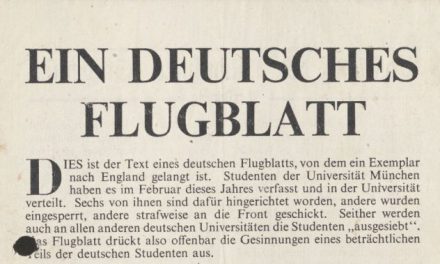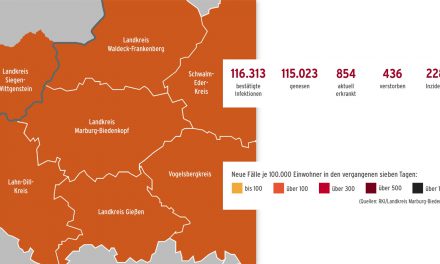Der Marburger Kamerapreis geht in diesem Jahr an den norwegischen Bildgestalter Sturla Brandth Grøvlen. Im Interview mit dem Express erzählt er von seiner Faszination für die Dunkelheit und wie das Vatersein seine Kunst beeinflusst.
Express: Herr Grøvlen, Sie haben bei vielen verschiedenen Projekten mitgearbeitet – vom Kurzfilm über den abendfüllenden Film bis zu Dokumentationen und Musikvideos. Worin liegt der Reiz, an verschiedenen Formaten zu arbeiten?
Sturla Brandth Grøvlen: Ich denke, in den letzten Jahren hat sich mein Fokus auf den Spielfilm konzentriert, also Fiktion. Die meisten Bildgestalter:innen träumen davon, Fiktion-Filme oder abendfüllende Dokumentationen zu drehen, wenn sie zur Filmschule gehen. Aber ich denke, das Tolle an unterschiedlichen Formaten ist, dass man auf verschiedene Weise inspiriert wird. Ich habe durch die Arbeit an Dokumentationen so viel darüber gelernt, was es heißt, Bildgestalter zu sein, was ich dann auch in meine Arbeit an fiktionalen Filmen einfließen lassen konnte. Sich natürliche Lichtquellen zu suchen, anstatt künstliche zu erschaffen, zum Beispiel. Diese Dinge kann man von einem Format ins andere transportieren. Ich mag es auch, in Kurzformaten zu arbeiten, weil man schneller von einer Idee zu einem Ergebnis gelangt. Bei abendfüllenden Filmen kann es ein oder sogar mehrere Jahre dauern, bis man wirklich anfängt, daran zu arbeiten und ein Ergebnis hat. Und in diesem Prozess kann man seine Perspektive ein wenig verlieren. Kürzere Projekte können sehr inspirierend sein, da sie so ergebnisorientiert sind.
Die Fiktion-Filme, die Sie gedreht haben, gehören ganz unterschiedlichen Genres an. Aber egal, ob ein Film actionreiche, komödiantische oder fantastische Elemente enthält, tragen sie alle eine gewisse Dunkelheit in sich. Was zieht Sie zu diesen düsteren Geschichten hin?
SBG: Das ist mir selber auch aufgefallen. Es ist nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung. Ich denke, es muss etwas in meiner Kindheit oder Erziehung gewesen sein, was meine Faszination für das Dunkle ausgelöst hat. Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, weil ich gerade selbst zum ersten Mal Vater geworden bin. Und ich wurde neugierig, wie die Umgebung meines Sohns seine Kreativität und Fantasie beeinflusst. Meine Eltern sind Akademiker, keine Künstler. Ich mache Musik, die beiden haben keinen musikalischen Knochen in sich. Also habe ich meine Imagination nicht unbedingt von ihnen geerbt. Aber ich erinnere mich an eine schwarz-weiße Fotografie, die in unserem Treppenhaus hing. Sie war etwas bedrohlich und dunkel. Ich glaube, es waren einfach Blumen darauf zu sehen, aber das Bild war sehr kontrastreich. Vielleicht war es so etwas, was mich fasziniert hat. Vielleicht auch etwas anderes. Dass es etwas gibt, was man nicht ganz verstehen kann, was außerhalb unserer Reichweite ist, ist auch mit Magie verbunden. Ich fühle mich zu den Geschichten und Bildern hingezogen, die diese Dunkelheit in sich tragen. In den Schatten liegen Geheimnisse (lacht).



Bezieht sich diese Vorliebe auch auf Filme, die Sie selber gerne schauen?
SBG: Ja, das bezieht sich auf Filme und auch andere Arten von Kunst wie Gemälde oder Fotografie. Es war noch präsenter, als ich jünger war. In den letzten Jahren fühle ich mich auch etwas mehr zu helleren Dingen hingezogen und ich schaue Filme, die einen leichteren Ton haben. Vielleicht gerade, weil ich mich in meiner Arbeit so viel mit Dunkelheit auseinandersetze (lacht). Es geht um die Balance.
Ein Highlight Ihrer Karriere war die Arbeit am Film „Victoria“ (R. Sebastian Schipper, 2015), für den Sie bei der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet worden sind. Der 140-minütige Film wurde von Ihnen ohne einen einzigen Schnitt gedreht. Von Clubszenen bis zu einem Bankraub bleibt die Kamera ungeschnitten an den Figuren dran. Es gibt auch Filme, die lediglich so geschnitten werden, dass sie wie eine einzige Aufnahme (One-Take) aussehen. Haben Sie diese Möglichkeit diskutiert, als Sie an „Victoria“ gearbeitet haben?
SBG: Von Beginn an war es Teil unserer Strategie, dass wir den Film schneiden würden, wenn der One-Take nicht funktioniert hätte. Wir hatten drei Wochen für Übungsdurchläufe, die wir alle gefilmt haben, als sei es der echte Film. Wir wussten, diese Aufnahmen könnten wir für den Schnitt verwenden, wenn unsere Idee vom One-Take fehlschlagen würde. Letztendlich hatten wir dann drei Versuche, den One-Take aufzunehmen. Der erste Versuch war zu energetisch, beim zweiten wollte niemand die Fehler des ersten wiederholen. Erst beim dritten Mal haben wir die richtige Balance gefunden. Ich erinnere mich daran, dass einige Produzent:innen einen geschnittenen Film sehen wollten. Aber Sebastian Schipper, der Regisseur, hat darauf bestanden, dass wir den One-Take verwenden und keine versteckten Schnitte machen werden. Und das ist mein Film. Er war sehr selbstbewusst, dass es funktionieren würde.
Ihr Name wird im Abspann von „Victoria“ als erster genannt. Normalerweise ist es der Name des Regisseurs oder der Regisseurin. Spiegelt diese Tatsache die Beziehung wider, die Sie zu Sebastian Schipper am Set von „Victoria“ hatten? Und war sie anders als die Beziehung zu anderen Regisseur:innen?
SBG: Ich denke, es spiegelt seine Großzügigkeit und sein Vertrauen in mich wider. Ich wusste nichts davon, bis ich den Film bei der Premiere gesehen habe. Das war eine sehr großzügige Geste von ihm. Ich denke, die Natur des Projekts hat verlangt, dass er viel Vertrauen in mich gesetzt hat während des Filmens. Ich durfte – und sollte – mit den Schauspieler:innen kommunizieren, da ich ihnen am nächsten war. Sebastian musste sich verstecken und konnte nicht immer zuschauen oder alles hören. Also musste ich stark in seine Vision des Projekts involviert sein. Vielleicht mehr, als ich es bei anderen Regisseur:innen sein darf.
Also war Ihre Beziehung zu den Schauspieler:innen auch anders als sonst.
SBG: Ja, sehr. Die Zusammenarbeit und Verbindung zwischen Bildgestalter:innen und Schauspieler:innen ist immer stark, aber hier besonders. Wir hatten eine Regel, dass sie mich wie einen Teil der Gruppe behandeln mussten, damit ich sie nicht verliere, wenn sie durch die Straßen laufen. Es hat sich beinahe so angefühlt, als wäre ich selbst eine der Figuren.
Das hat sich auch im Film niedergeschlagen.
SBG: Es freut mich, dass Sie das sagen. Als wir den Dreh vorbereitet haben und ich immer mehr die Rolle einer Figur übernommen habe, konnte ich umso involvierter sein im emotionalen Leben der anderen Figuren. Und desto besser wurde auch meine Kameraführung. Das ist ebenfalls etwas, was ich in meine Projekte implementieren konnte, die nach „Victoria“ kamen.
Sie sind einer der jüngsten Gewinner des Marburger Kamerapreises und es wartet hoffentlich noch eine lange Karriere auf sie. Gibt es eine Errungenschaft, künstlerisch oder technologisch, die Sie noch erreichen möchten?
SBG: Ich habe viel darüber nachgedacht. Gerade auch, weil ich nun Vater geworden bin. Ich habe Freunde und Kollegen, die in ihren späten Zwanzigern oder frühen Dreißigern sind und am Anfang ihrer Karrieren stehen. Sie machen sich Sorgen über die Zukunft, weil sie eine Familie gründen und gleichzeitig eine Karriere starten wollen. Ich habe bereits eine – vielleicht nicht lange – aber umfangreiche Karriere hinter mir. Ich kann mich darauf fokussieren, eine Familie zu gründen, und ich muss keinen Jobs mehr hinterherlaufen. Ich habe viele Projekte gemacht, mit denen ich künstlerisch sehr zufrieden bin. Ich habe kommerzielle Filme gemacht, experimentelle und Hybride der beiden. Ich bin glücklich darüber, wo ich in meiner Karriere stehe und es gibt nichts, was ich dringend verfolgen muss. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die Filme, die mir angeboten werden, immer größer und kommerzieller werden. Ich möchte davon nicht verführt werden, denn ich mache kleinere Arthouse-Filme lieber. Ein Film wie „Last and First Men“ (R. Jóhann Jóhannsson, 2020) liegt mir sehr am Herzen und ich würde gerne mehr Projekte wie dieses tun. Ich habe bei diesem Dreh viel über europäische Geschichte gelernt, mehr als bei jedem anderen Film. Ich mag Projekte, bei denen ich richtig in ein Thema eintauchen kann.
Zur Person: Sturla Brandth Grøvlen ist 1980 im norwegischen Trondheim geboren und hat sein Filmstudium sowohl in Norwegen als auch in Dänemark absolviert. Seine Werke rangieren zwischen verschiedensten Genres wie Thriller, Kriegsfilm, Fantasy oder Drama. Mit „Victoria“ (R. Sebastian Schipper, 2015), dem erst zweiten abendfüllenden Spielfilm seiner Karriere, zog er das Interesse vieler Filmschaffenden auf sich. Einem breiteren Publikum wurde er durch die Arbeit an „Der Rausch“ (R. Thomas Vinterberg, 2021) bekannt, der mit dem Oscar für Besten Internationalen Film ausgezeichnet wurde. Grøvlens Kameraführung zeichnet sich durch eine große Dynamik sowie Nähe zu den Figuren aus. Oft implementiert er skandinavische Lichtverhältnisse in seine Szenen und scheut nicht davor zurück, mit hohen Kontrasten und Dunkelheit zu arbeiten. Grøvlen lebt mit seiner Familie in Kopenhagen.
Interview: Johanna Rödiger