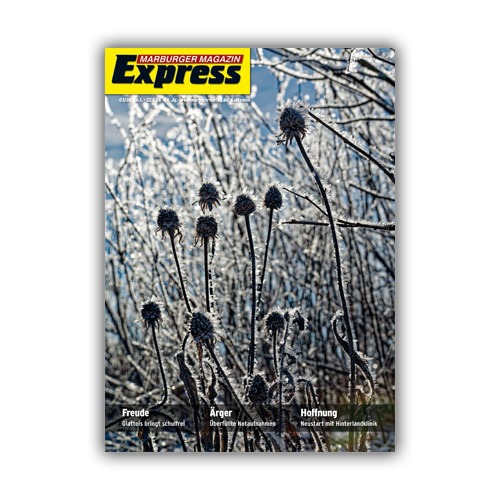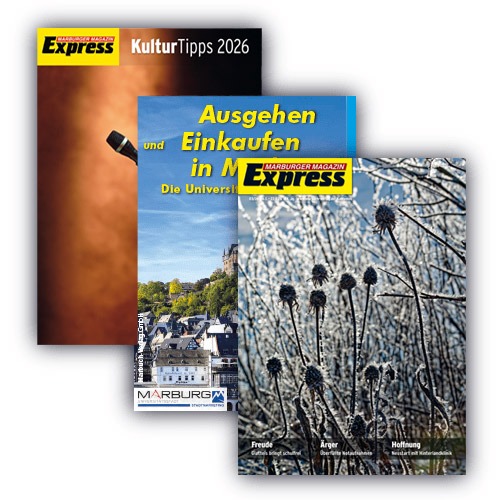Um die Klimaziele zu erreichen, setzt die Verkehrspsychologin Prof. Angela Francke auf mehr, besseren und sicheren Radverkehr. Sie forscht an der Frage, was Menschen vom Drahtesel abhält. Am Dienstag, 8. Juli, spricht sie ab 16.15 Uhr über „Wege zur Mobilitätswende“ im großen Hörsaal der Marburger Physik (Renthof 5). Ihr Vortrag gehört zur Vorlesungsreihe „Nachhaltigkeit in der Krise“.
Regennass auf offiziellen Terminen anzukommen, macht Angela Francke nichts aus. Sie trägt auch keine besondere Radkleidung, wenn sie mit ihrem City-Bike durch die Straßen radelt. Angela Francke ist Professorin für Radverkehr und Nahmobilität. Ihre Vision sind grüne, sichere und lebendige Städte, die zum Radeln und Spazieren einladen. Ihr Ziel: Das Mobilitätsverhalten so zu beeinflussen, dass es neben dem öffentlichen Nahverkehr zum Verkehrsmittel Nummer eins wird. Und dazu setzt sie auf ganzjähriges Radeln – egal, ob es regnet oder schneit. Allerdings müssten die Menschen dann sicher sein, dass die wichtigsten Radwege prioritär bis 7 Uhr geräumt werden, hat sie in einem Forschungsprojekt festgestellt.
In Franckes Büro steht ein Räuchermännchen mit Fahrrad. Schließlich kommt die 45-Jährige aus Dresden, wo sie Verkehrswirtschaft mit den Schwerpunkten Verkehrspsychologie, Logistik und Tourismus an der TU studiert hat. In ihrer alten Heimat stehen zwei Dutzend historische Räder in der Garage. Prunkstück ist ein schwarzes Diamant-Rad aus den 30er Jahren, das zuletzt bei einer Ausstellung von Fahrrad-Veteranen im September zu sehen war. Die Leidenschaft für die Fahrräder packte sie schon als Kind.
Ihre Promotion über Preissysteme zur Förderung von umweltfreundlicher Mobilität wurde zweifach preisgekrönt. Dabei zeigte sich, dass gebührenpflichtiges Parken beim Arbeitgeber ein entscheidender Hebel ist, wenn man Menschen zum Umstieg auf klimafreundlichere Verkehrsmittel bewegen möchte. Erst, wenn die Parkplätze etwas kosten, beginne das Rechnen. Allerdings dürfe das System dann nicht zu kompliziert sein. Parkgebühren von 80 Cent für 20 Minuten oder 1,80 Euro für eine Stunde könnten die meisten Menschen nicht leicht genug umrechnen. Stattdessen empfahl sie schon damals Systeme wie das Deutschlandticket, das nun wieder untersucht wird. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Dresdner Lehrstuhl für Verkehrspsychologie forschte sie weiter zu ganzjährigem Fahrradfahren und zum Mobilitätsverhalten während der Corona-Pandemie – da waren die Radler die einzige Gruppe, die das tägliche Pendeln vermisste.
Seit 2021 ist sie nun Professorin für Radverkehr und Nahmobilität an der Universität Kassel. Dabei handelt es sich um eine der sieben Radprofessuren, die 2020 vom Bundesverkehrsministerium eingerichtet wurden. Damit ging für Angela Francke ein Traum in Erfüllung. Neben ihrem Büro gibt es ein Mobilitätslabor, in dem Studierende und Mitarbeiter mithilfe von Fahrradsimulatoren, Sensoren sowie Szenarien von Virtual Reality erproben, wie sich Veränderungen der Infrastruktur auf das Erleben und Verhalten der Verkehrsteilnehmer auswirken. In Franckes Studiengang werden die zukünftigen Radverkehrsplaner und Radverkehrsmanager ausgebildet. Die Absolventen sind begehrt. Täglich bekommt Francke Anfragen von Städten und Kreisen, die ihre Stellen besetzen wollen.
„Der Verkehrssektor ist der einzige Bereich, der die Klimaziele der Bundesregierung nicht erreicht“, erläutert die Expertin. Deshalb müsse das Radfahren gefördert werden. Zudem sei es ein sehr demokratisches, kostengünstiges Verkehrsmittel mit einer sehr langen Lebenszeit, sagt Francke: „Es hat nachweislich gute mentale und gesundheitliche Effekte insgesamt. Man ist draußen und hält sich fit.“ Auf Strecken bis zu fünf Kilometern sei es das schnellste Verkehrsmittel, weil man von Tür zu Tür fährt.
Angela Francke will herausfinden, warum Menschen Rad fahren und was sie davon abhält. So beginnen viele mit dem Radfahren, wenn sich etwas in ihrem Leben verändert. Das reicht von der Pandemie über Strukturwandel bis zur Geburt eines Kindes. Ein großes Thema ist das Sicherheitsempfinden, das vor allem bei Frauen dazu führt, dass nicht radeln. Überall dort, wo es eine geschütztere Infrastruktur für Radfahrer gibt, steigt der Anteil der Frauen und Kinder. „Fahrradfahren darf keine Mutprobe sein“, sagt die Verkehrspsychologin. Ein weiterer Weg zu mehr Sicherheit sei ein Tempolimit.
Allerdings müsse sich auch die Kultur des „Windschutzscheibenblicks“ und das autozentrierte Denken in den Köpfen ändern. Für viele Menschen sei das Auto immer noch ein wichtiges Statussymbol. Dagegen fahre in den Niederlanden auch der König mit dem Rad: „Es sollte die Regel sein, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein“, sagt Francke.
Die Verkehrspsychologin weiß natürlich, dass ihr Thema polarisiert. Das „Hybridwesen“ des Radelnden müsse sich den begrenzten Platz auf den Straßen mit Autofahrern und Fußgängern teilen. Der Radfahrer werde dann oft nur als jemand wahrgenommen, der Platz wegnehme. Hier setzt sie auf Kommunikation und Perspektivwechsel. Allerdings erinnert sie daran, dass jeder Mensch, der nicht mit dem Auto unterwegs sei, den verbleibenden Pkw-Verkehr flüssiger macht. Und natürlich hat sich durch die E-Bikes viel verändert, weil Berge und fehlende Kondition eine geringere Rolle spielen: „Pedelecs sind der absolute Gamechanger“, sagt Francke. Inzwischen ist schon jedes zweite verkaufte Rad ein E-Bike.
Gesa Coordes
Wer den Vortrag vor Ort nicht besuchen kann, hat die Möglichkeit, sich online zuzuschalten: https://webconf.hrz.uni-marburg.de/n/rooms/rfb-hc2-ng9-mr3/join