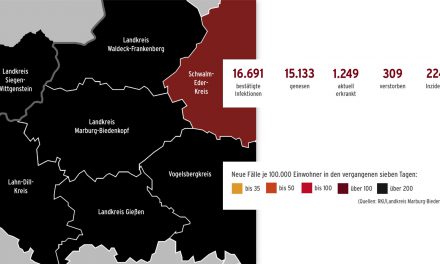Die Bilanz der Initiative „Notruf 113“ klingt bitter: „Für Marburg haben wir nichts erreicht, nur die Bevölkerung sensibilisiert“, sagt Sprecherin Ulrike Kretschmann. Aber immerhin: Andere hätten aus ihren Erfahrungen mit der Privatisierung des Uni-Klinikums Marburg gelernt. So nahmen CDU und FDP in Schleswig-Holstein Abstand vom Verkauf ihres defizitären Uni-Klinikums. Und die Gruppe mischt sich immer noch ein. Als SPD-Bundesvorsitzende Andreas Nahles im September nach Marburg kam, überreichte Kretschmanns siebenjähriger Sohn das „Märchen von einem Leuchtturm, der an die Piraten verkauft wurde“ (s. Kasten). Die Sozialdemokratin fand es „super“.
Jetzt will die Gruppe bis zu Gesundheitsminister Jens Spahn vordringen, um ihm klarzumachen, dass die von ihm angekündigten Personalmindeststandards in den Krankenhäusern nicht ausreichen. Nach den bisherigen Plänen sollen nämlich die gleichen Standards in Kreiskrankenhäusern wie in Uni-Kliniken gelten. In den Kliniken der Hochschulen landen jedoch viel schwerere und kompliziertere Fälle, die Uni-Klinika müssten daher besser ausgestattet werden. „Wenn es gute Mindeststandards gäbe, könnten Krankenhausbetreiber diesen Reibach nicht mehr machen“, erläutert Kretschmanns Kollegin Marion Twelsiek.
Vor knapp zehn Jahren hat sich das Bündnis gegründet, in dem sich vor allem niedergelassene Ärzte, aber auch Psychologen, Juristen und Pflegekräfte engagieren. Damit schlossen sie sich erst drei Jahre nach dem Verkauf des Universitätsklinikums an den Krankenhausbetreiber Rhön zusammen. Gründungsversammlung war am 11.3.2009, daher der Name „Notruf 113“. Erst zu diesem Zeitpunkt sei ihnen klar geworden, wie stark sich die medizinische Versorgung verschlechtert habe, sagt Allgemeinärztin Kretschmann: „Das war wirklich ein eklatanter Einbruch.“ Gemeinsam mit anderen Medizinern beklagte sie eine „Drehtürmedizin“, die dazu geführt habe, dass vor allem die komplizierten Problemfälle schlechter versorgt wurden als früher. Ihr Kollege, der Psychologe Micha Brandt, sagt, das Universitätsklinikum sei nach seinem Eindruck „systematisch von einem Haus der Maximalversorgung hin zu einem Spezialisten für ‚lukrative Erkrankungen‘ umstrukturiert worden. Zugleich klagten Klinik-Mitarbeiter über hohe wirtschaftliche Zielvorgaben und gestiegene Arbeitsbelastung. „Die Rhön AG folgt dabei einem kaufmännischen Rational“, so Brandt: „Sie kann als Aktiengesellschaft gar nicht anders.“
Notruf 113 organisierte Mahnwachen, Diskussionsrunden und prangerte die Zustände im Klinikum immer wieder in den Medien an. 2011 eskalierten die Auseinandersetzungen mit dem Rhön-Konzern derart, dass Ulrike Kretschmann und zwei weitere Ärzte eine sogenannte Unterlassungserklärung erhielten, in der sie aufgefordert wurden, strittige Aussagen gegen das Unternehmen in Zukunft zu unterlassen. Sonst drohten hohe Geldstrafen.
In den letzten Jahren wurde es ruhiger um das privatisierte Uni-Krankenhaus. Doch Kretschmann betont: „Die Ökonomie steht weiterhin im Vordergrund.“ Die Arbeitsbelastung der Beschäftigten sei weiter sehr hoch. Sie müssten nicht nur Gewinne erwirtschaften – auch die Investitionen müssten aus dem laufenden Betrieb finanziert werden. Zudem habe sich die Ausbildung der Studierenden verschlechtert.
Durch die aktuelle Entwicklung sehen sich die Privatisierungsgegner erneut bestätigt. Das Ionenstrahltherapiezentrum für Krebskranke – ein weiteres „Leuchtturmprojekt“ der Regierung Koch – hat im September Insolvenz angemeldet. Für einen kostendeckenden Betrieb konnte das Zentrum nicht genügend Patienten behandelt. Unikliniken seien schon immer defizitär und teuer gewesen, sagt Kretschmann dazu. Und Micha Brandt erinnert daran, dass das aufwändige Zentrum Bestandteil des Kaufvertrages zwischen Rhön und dem Land war: „Da steht nichts davon, dass es auch rentabel sein muss.“ Deswegen sei der Kaufpreis niedriger gewesen. Brandt: „Das ist ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man die Kontrolle über so einen wichtigen Bereich abgibt.“
Hintergrund
Das fusionierte Universitätsklinikum Gießen und Marburg wurde Anfang 2006 für 112 Millionen Euro an den Krankenhausbetreiber Rhön verkauft. Bis heute handelt es sich um die bundesweit einzige Privatisierung eines Universitätsklinikums. Hauptgrund war der Investitionsstau, durch den das Gießener Klinikum von der Schließung bedroht war. Das war auch der Grund, warum die Privatisierung zum Teil in Gießen begrüßt wurde. Dagegen gehörte Marburg vor der Privatisierung zu den wenigen rentablen Uni-Krankenhäusern in Deutschland.
Der damalige Ministerpräsident Roland Koch bezeichnete den Verkauf als „Leuchtturmprojekt“. Dagegen sprach sogar die Marburger CDU später vom „Fehler der Privatisierung“.
– gec
Gemeinsam für unser Klinikum
Als zweite Bürgerinitiative formierte sich 2011/12 das Bündnis „Gemeinsam für unser Klinikum“ in Marburg. Anlass war die Ankündigung eines weiteren Stellenabbaus am Klinikum. „Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte“, sagt Bündnissprecher Dieter Unseld. Hauptziele der Initiative, in der sich Gewerkschafter, Pflegekräfte, Vertreter von Linken, SPD und Grünen sowie interessierte Bürger engagieren, sind eine gute Patientenversorgung sowie gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Zugleich wollten sie „über politische Grenzen und berufliche Zusammenhänge hinweg“ eine Brücke zwischen den Klinik-Mitarbeitern und der Stadtgesellschaft bilden. Auch Notruf 113 arbeitet mit dem Bündnis zusammen.
So organisierten sie im März 2013 gemeinsam die große Demonstration gegen die Sparpläne des Großkrankenhauses – mehr als 2000 Menschen protestierten gegen den Stellenabbau. „Gemeinsam für unser Klinikum“ sammelte mehr als 50 000 Unterschriften gegen die Stellenabbaupläne und versuchte, mit einer von 1500 Menschen unterzeichneten Petition 2012 die Privatisierung rückgängig zu machen. Seitdem hat sich das Bündnis immer wieder – etwa in Tarifauseinandersetzungen – zu Wort gemeldet, um die Klinik-Beschäftigten beim Kampf um mehr Personal zu unterstützen.
– gec
Das Märchen vom irrlichternden Leuchtturm
Es war einmal ein strahlender Leuchtturm, der strahlte so hell und so weit, das er im ganzen Land bekannt war. Nicht weit entfernt stand ein weiterer Leuchtturm, der nicht ganz so hell leuchtete und so geschah es, dass ein böser Landesvater daher geritten kam und meinte, er wolle den einen, nicht so hell leuchtenden Turm loswerden.
Schon sann er auf den Plan, die beiden Leuchttürme für kleines Geld an Piraten zu verkaufen, die nur beide Türme zusammen kaufen wollten. So geschah es und es vergingen die Jahre. Die Piraten konnten mit den Türmen machen, was sie wollten, auch wenn Gestrandete und die Landbevölkerung jammerten und klagten. Obwohl der böse Landesvater längst in die Flucht geschlagen war, änderten die neuen Landesväter nichts. Sie hielten sich die Ohren zu oder fanden schöne Worte.
Und was taten die Piraten? Sie machten einfach weiter, was Piraten so tun: plündern. Dazu erfanden sie immer neue Piratengeschichten, in denen sie stets aufs Neue behaupteten,dass ihr Tun zum Wohle der Bevölkerung sei. Sie lobten sich unverdrossen mit dem Werbespruch “ Spitzenleuchttürme für Jedermann“. Die Menschen versammelten sich und beratschlagten, was gegen die Piratenplage zu tun sei. Als wieder einmal eine Neuwahl eines Landesvaters unmittelbar bevorstand, fragten sie: Wie lassen sich die irrlichternden Leuchttürme, die so viele Boote angelockt und haben zerschellen lassen, auf ihre ursprüngliche Aufgabe zurückführen, den Menschen den rettenden Weg zu leuchten? Wer will, kann und muss die Türme retten? Und wie können die Piraten dazu gebracht werden, ihr menschenfeindliches Treiben aufzugeben?
So viele Fragen. Und wenn die Piraten nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Gesa Coordes