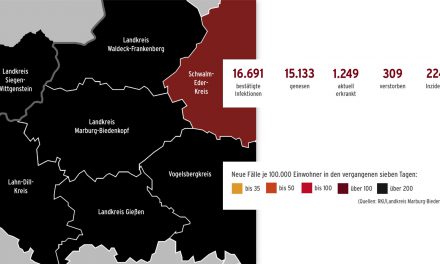Mit Hélène Louvart erhält zum dritten Mal in seiner 18-jährigen Geschichte eine Frau den Marburger Kamerapreis als Auszeichnung für hervorragende Bildgestaltung im Film.
Die 1964 in Pontarlier geborene Französin arbeitet seit über 40 Jahren als bildgestaltende Kamerafrau und ist für die Bilder bei mehr als 65 abendfüllenden Filmen, 50 Kurzfilmen und 10 Fernsehprojekten verantwortlich. Zu den bekanntesten Filmen, bei denen Louvart hinter der Kamera stand, zählt Wim Wenders‘ 3D-Dokumentation „Pina“ über Pina Bausch. „Hélène Louvart wechselt virtuos zwischen den unterschiedlichsten Anforderungen und schafft dabei immer wieder Bilder, die Regie, Drehbuch und Schauspiel kongenial ergänzen. Auffällig oft ist sie bei kleinen und experimentellen Projekten dabei, nur selten fotografiert sie aufwändige Filme, sondern sie folgt konsequent einer eigenen Linie, die stets die künstlerischen Möglichkeiten höher schätzt als das Renommee der großen Namen und Budgets“, heißt es in der Begündung der Jury, und weiter: „Ihre Fotografie ist zuallererst der Welt zugewandt und interessiert sich für die unendlichen Nuancierungen des Lichtes und der Gegenstände. Sie ist im besten Wortsinn eine dokumentarische Bildgestalterin, die dabei aber nie den Blick für die Magie und Lyrik der Realität verliert.“
Hélène Louvart nimmt den von der Philipps-Universität und der Stadt Marburg vergebenen und mit 5000 Euro dotierten Marburger Kamerapreis am Samstag, den 28. April 2018 um 20.00 Uhr in der Alten Aula der Philipps-Universität Marburg entgegen. Am 28. und 29. April finden wie jedes Jahr die Bild-Kunst-Kameragespräche rund um die Preisvergabe in den Filmkunsttheatern Marburg statt.
Express: In der Internet Movie Database (IMDB) sind Sie mit mehr als 100 Einträgen seit 1986 verzeichnet – Man könnte glauben, Sie seien ein Kamera-Workaholic. Legen Sie Ihr Arbeitsgerät jemals aus den Hand?
Hélène Louvart: Sobald man an einem Film mitarbeitet – auch wenn es nur sehr kurz ist – bekommt man einen Eintrag in der Internet Movie Database. Insofern hat es wenig Bedeutung, wenn ich dort mehr als 100 Einträge habe. Ich bin kein „Workaholic“. Ich mache meine Arbeit wie jeder auch, aber mit großer Begeisterung. Ich suche die Filme aus, an denen ich arbeiten möchte. Außerdem habe ich ein Familienleben, das für mich sehr wichtig ist. Die Arbeit als Bildgestalterin besteht auch darin, sich Zeit zu nehmen, um den Film vorzubereiten, die Motive zu erkunden und eine Liste von Einstellungen anzufertigen, sich an der technischen Durchführung der Dreharbeiten zu beteiligen und anschließend die Farbkorrektur zu machen, wenn die Montage beendet ist.
Damit will ich sagen, dass ich nicht immer meine Kamera in der Hand habe, ganz im Gegenteil. Die Bilder, die man im fertigen Film sieht, sind gewissermaßen nur der sichtbare Teil des Eisbergs der Arbeit, der unsichtbare Teil ist all die Arbeit im Hintergrund.
Express: Wie sind Sie zur Künstlerischen Bildgestaltung gekommen?
Hélène Louvart: Ich sage lieber: Wie bin ich zu meinem Beruf gekommen? Denn es ist ein Beruf, den wir ausüben, auch wenn dieser zugegebenermaßen mit künstlerischen Konzepten in Verbindung steht. Zunächst und vor allem ist es aber ein Beruf wie andere auch. Ich war zwei Jahre lang in der Ecole Louis Lumière in Paris, dann habe ich angefangen, Kurzfilme zu drehen wie auch Dokumentarfilme, meist im Ausland und auf Super-16mm, später dann auch Spielfilme. Ich bin nie Assistentin gewesen. Schritt für Schritt ist meine Arbeit so anerkannt worden.
Express: Von Agnes Varda und Claire Denis bis Wim Wenders und Tim Sutton haben Sie mit den vielfältigsten Regisseuren gedreht – Wie bereiten Sie sich auf ihre jeweilge Arbeit vor?
Hélène Louvart: Ich lese zuerst das Drehbuch, dann treffe ich mich natürlich mit dem Regisseur oder der Regisseurin, und wir tauschen uns über unsere Vorlieben aus und darüber, was uns weniger gefällt. Natürlich immer mit Blick auf den Film, den wir vorbereiten. Meine Arbeit besteht darin, ein visuelles Universum nach den Wünschen des Regisseurs oder der Regisseurin zu verwirklichen. Man muss also jemandem genau zuhören und zugleich dieses in finanzielle Möglichkeiten übersetzen, die notgedrungen stark unsere Wahlmöglichkeiten bestimmen.
Es ist wirklich eine intensive Zusammenarbeit von beiden Seiten und der interessanteste Aspekt dieses Berufs. Das ist viel mehr, als nur eine Kamera in der Hand zu halten. Ich habe übrigens nur einmal mit Claire Denis zusammengearbeitet. Ich bin für Agnès Godard eingesprungen, mit der sie oft und sehr erfolgreich zusammenarbeitet.
Express: Sie filmen in Super-16mm- und im klassischen 35mm-Format, aber auch digital. Haben Sie ein Lieblingsmedium?
Hélène Louvart: Nein, ich mag alle drei, Super-16mm genauso wie 35mm oder Digital; und auch das Digitale mit einer kleinen Kamera oder mit einer technisch entwickelten Kamera.
Jedes Format hat seine Beschwerlichkeiten und Vorteile, seine Fehler und Qualitäten. Es sind verschiedene Werkzeuge, zunächst aber Werkzeuge, mit denen wir eine Geschichte erzählen können. Die Wahl des Mediums hängt auch mit der zu erzählenden Geschichte und den Vorlieben des Regisseurs zusammen.
Die Kamera ist ein Bleistift. Man muss wissen, wie man das leere Blatt füllt.
Express: In Wim Wenders‘ Tanzfilm-Dokumentation „Pina“ von 2011 arbeiten Sie in 3D, für das Amoklauf-Drama „Dark Night“ von Tim Sutton kommt 2016 die Hand-Held-Kamera zum Einsatz. Wie nutzen Sie diese technischen Mittel?
Hélène Louvart: Die Erfahrung, „Pina“ in 3D zu drehen, war etwas ganz Besonderes. Wir mussten die Kamera sehr präzise bewegen, weil die Choreographie in jedem Moment der Szene genau festgelegt war. Wir haben dafür die zu jener Zeit besten Kameras benutzt, jeweils zwei, entsprechend dem Prinzip von 3D. Da wir während der Darbietungen nicht auf der Bühne bleiben konnten, hatten wir einen Kran, der sich hin und her bewegte. Die technischen Aspekte hingen also damit zusammen, was wir drehten.
Kein Vergleich mit „Dark Night“ von Tim Sutton, der eine viel nähere Kameraführung benötigte, aber auch transparenter gegenüber den Menschen und der Geschichte. Also eine beweglichere und leichtere Kamera, die auch kein 3D aufnahm.
Man kann diese zwei sehr unterschiedlichen Filme nicht vergleichen. Jeder hat seine eigene kinematographische Sprache.
Express: Die Namen von Kameramännern stehen nicht selten im Schatten von Filmstars und Regisseuren. Gilt das in noch stärkerem Maße für Kamerafrauen?
Hélène Louvart: Ich habe nicht den Eindruck, dass die Namen von Kamerafrauen weniger oft genannt werden als die ihrer männlichen Kollegen. Dass wir im Schatten des Regisseurs oder der Schauspieler stehen, das ist normal. Auch wenn ein Film von einem ganzen Team hergestellt wird, so bleibt er doch das Werk einer Person, eines Regisseurs oder einer Regisseurin. Und die Schauspieler sind diejenigen, die man auf der Leinwand sieht. Es ist also normal, sie zu nennen.
Damit beschützt man auch die Vorgehensweisen der „Traumfabrik“. Der Kameramann oder die Kamerafrau bleiben verborgen, und das finde ich richtig. Übrigens, wir reden ebenso über einen Kameramann wie über eine Kamerafrau. Vor allem wenn wir künstlerisch zu einem Film beitragen, um ihm eine Form der Anerkennung durch das Publikum zu verschaffen.
Express: 2018 wurde mit Rachel Morrison erstmals eine Kamerafrau für den Oscar nominiert. Warum hat es dafür 90 Jahre gebraucht?
Hélène Louvart: Ich weiß es nicht. Vielleicht weil sie die erste Kamerafrau ist, die einen Film fotografiert hat, der für die Oscars nominiert wurde. Aber ehrlich gesagt – ich stelle mir diese Art von Fragen nie.
Herzlichen Dank an Marie-Hélène Borscheid von der Deutsch- Französischen Gesellschaft Marburg und Malte Hagener von der Philipps-Universität für die Übersetzung.
Interview: Michael Arlt